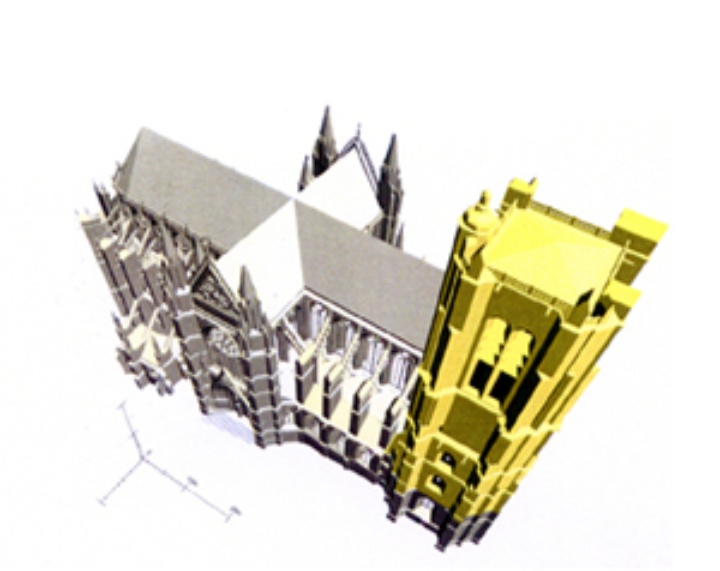Die „Weiße Stadt“ Tel Aviv ist mit rund 4.000 Gebäuden, von denen fast 1.000 unter Denkmalschutz stehen, das weltweit größte zusammenhängende Architekturensemble von Bauten der Moderne und von großer architekturgeschichtlicher und historischer Bedeutung. Die „Weiße Stadt“ ist Teil des UNESCO-Weltkulturerbes.
Die „Weiße Stadt“ ist aktuell durch zunehmenden Druck auf dem Immobilienmarkt, nicht ausreichende Bauunterhaltung bzw. -sanierung und geänderte nutzerseitige Anforderungen erheblich gefährdet. Das Bundesbauministerium unterstützt die Stadt Tel Aviv in diesem Zusammenhang beim Aufbau eines Denkmalschutzzentrums. Kern ist der Aufbau eines deutsch-israelischen Kooperationsnetzwerkes. Dieser Prozess wird wissenschaftlich begleitet. Im Fokus dieses Ressortforschungsvorhabens steht neben einer Auseinandersetzung mit Gebäuden in Deutschland und Israel auch die Vermittlung bautechnischer und handwerklicher Kompetenzen für eine denkmalgerechte Sanierung.
Das Institut für Architekturgeschichte (Dr. -Ing. Dietlinde Schmitt-Vollmer) bearbeitete das Forschungsprojekt gemeinsam mit dem Büro für Restaurierungsberatung Bonn / Meitingen und dem Institut für Werkstoffe im Bauwesen, Universität Stuttgart. Denkmalrelevante Fragestellungen, Bauforschung und Themen der energetischen Sanierung konnten in Tel Aviv und in Deutschland erörtert werden.
Die Grundlage der Weißen Stadt Tel Aviv wurde mit dem berühmten Town Planning Scheme des schottischen Biologen und Soziologen Patrick Geddes 1927 gelegt, der eine großzügige Stadterweiterung Tel Avivs als blühende großzügige Gartenstadt vorsah. Die Grundstücke wurden ab 1927-1949 mit modernen Stadtvillen im Sinn des Internationalen Stils eng überbaut.
Die meisten dieser jüdischen Architekten waren in den 1930er und 40er Jahren angesichts zunehmenden Rassismus und Repressalien aus Osteuropa und Deutschland nach Palästina emigriert. Hier wollten sie neben den bestehenden arabischen Städten und Siedlungen ihre mitteleuropäischen Vorstellungen von Wohnbau umsetzen. Viele brachten große baupraktische Erfahrungen und detaillierte Kenntnis des Neuen Bauens in Berlin, Stuttgart, Breslau oder Magdeburg mit.
Andere Architekten waren schon als Teil der Zionistischen Bewegung in Palästina aufgewachsen und absolvierten ihr Architekturstudium an der TU Charlottenburg, in Paris, Gent, Breslau, Rom, London, Wien oder später auch am Bauhaus in Dessau.
Durch das Haávara Abkommen, welches die Transferierung des Vermögens der Emigranten von Deutschland nach Palästina reglementierte, wurde der Import deutscher Fabrikate, Produkte, Baumaterialien, Maschinen und in das britische Mandatsgebiet forciert. Schon zuvor war auch durch die aus der Gegend von Korntal stammenden pietistischen Templer eine rege „schwäbische Bauindustrie“ entstanden. Auch diese Templer wandten sich zunehmend dem Neuen Bauen zu.
Sehr komplex und an vielen Stellen sichtbar sind allein daher die historischen, bautechnischen und formalen Verknüpfungen zwischen der Architektur in Tel Aviv und den baulichen Zeugnissen vieler Regionen Deutschlands, des Werkbundes und des Neuen Bauens. Noch heute stammen viele Begriffe aus dem Baubereich aus dem Deutschen.
Die Ergebnisse des interdisziplinären begleitenden Ressortforschungsprojektes sollen 2014/2015 publiziert werden.